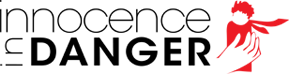Auswahl der Opfer
Bei sexuellem Missbrauch handelt es sich um geplante Taten. Menschen, die Kinder missbrauchen, überlegen im Vorfeld genau, welche Mädchen und Jungen „leichte Opfer“ sind. Sie suchen bewusst nach Kindern, zu denen sie einfach Kontakt aufnehmen können, die sich z.B. oft alleine fühlen, die nicht genügend anerkannt werden, die in einer schwierigen Elternbeziehung leben. Täter bzw. Täterinnen bevorzugen z.B. Mädchen, die gelernt haben, immer lieb, brav und vernünftig sein zu müssen, und Jungen, denen vermittelt wurde, dass „Indianer keinen Schmerz kennen“.
Kontaktaufnahme
Eine Strategie von Tätern oder Täterinnen ist es, gezielt kindgerechte Orte aufzusuchen, z.B. Schwimmbäder, Freizeitparks, um dort Kontakt zu Kindern aufzunehmen. Eine weitere Möglichkeit, „geeignete“ Opfer zu finden, bieten z.B. Sportvereine oder andere Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen. Neben ehrenamtlicher Tätigkeit suchen sich Täter und Täterinnen bewusst Berufsfelder, in denen sie mit Kindern zu tun haben. Sie betätigen sich z.B. als LehrerInnen, JugendgruppenleiterInnen, Hausmeister an Schulen, ErzieherInnen in Kindertagesstätten, ÄrztInnen, SchulbusfahrerInnen, SeelsorgerInnen.
Einige Täter halten bewusst Ausschau nach allein erziehenden Müttern, um sich über die Beziehung zur Mutter die Möglichkeit zu verschaffen, später ihre Kinder missbrauchen zu können.
Das Internet mit seinen vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten bietet darüber hinaus beste Gelegenheiten Mädchen und Jungen unmittelbar mit Mädchen und Jungen in Kontakt zu treten.
„Testrituale“
Nachdem der Täter bzw. die Täterin zu einem Kind bzw. Jugendlichen Kontakt aufgenommen hat, vertieft er oder sie nach und nach auf eine kindgerechte und altersangemessene Art und Weise die Beziehung. Dabei lässt er oder sie sich meistens Zeit, denn Ziel ist es, das Kind in eine emotionale Beziehung zu verstricken, die dem Kind wichtig ist.
Täter und Täterinnen „studieren“ Mädchen und Jungen, ihre Vorlieben, Abneigungen, lernen ihre Nöte und heimlichen Wünsche kennen. Gleichzeitig üben sie immer wieder – nur schwer erkennbare – sexuelle Grenzüberschreitungen („Testrituale“) aus. In der Umkleidekabine berührt ein Trainer wie zufällig die Scheide oder den Penis des Kindes. Scheinbar zufällig liegen in der Wohnung des Opas Zeitschriften mit pornographischen Abbildungen herum. Ein Lehrer äußert sexistische „Qualitätsurteile“ über die Entwicklung seiner Schülerin, eine Nachbarin gibt vor, das Kind aufklären zu wollen oder tarnt Übergriffe als Körperpflegehandlungen („Lass mich mal gucken, ob du auch richtig abgetrocknet bist.“). Im Chat werden ganz nebenbei sexuelle Themen angesprochen.
Täter und Täterinnen achten genau darauf, wie ihre potenziellen Opfer auf diese „Testrituale“ reagieren. Empören sich Kinder oder Jugendliche, setzen sie sich zur Wehr, oder klicken sie den Täter einfach weg, kommen sie als Opfer weniger in Frage. Die Täter und Täterinnen lassen meist von ihnen ab. Sie haben zwar Zeit und Mühe investiert, aber die Möglichkeit einer Entdeckung ist groß. Reagiert ein Mädchen oder ein Junge auf die „Testrituale“ eher schüchtern oder versucht sie zu ignorieren, ist das ein Signal für den Täter, die Beziehung zum Opfer weiter zu intensivieren.
Die Wahrnehmung der Umwelt vernebeln
Täter und Täterinnen gehen davon aus, dass Eltern für Kinder die erste Adresse sind, wenn es darum geht, sich Hilfe zu holen. Darum ist es für sie wichtig, einen guten Eindruck zu hinterlassen, um Verdachtsmomente gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aus Berechnung nehmen sie Kontakt zu den Eltern der Kinder auf oder vertiefen diesen.
Sie zeigen sich z.B. als hilfsbereiter Nachbar, der mit der Übernahme von Reparaturarbeiten, Babysitterdiensten oder Gewährung von Krediten einspringt. Auch bieten einige sich an, Fahrdienste zur Schule oder zum Einkaufen zu übernehmen, um Eltern zu entlasten. Ebenso festigen Geschenke an die Eltern oder das Herstellen günstiger Beziehungen das Bild eines netten Mannes ohne Fehl und Tadel. Täter bzw. Täterinnen, die beruflich mit Kindern arbeiten, haben oft den Ruf des engagierten Kinderfreundes, der sich für Rechte und Belange von Mädchen und Jungen einsetzt und brauchen sich bei den Eltern oftmals noch nicht einmal einzuschmeicheln.
Haben sich Täter oder Täterinnen einen guten Ruf erarbeitet, so haben sie ein Teilziel erreicht: Für das Kind ist es fast unmöglich, sich den Eltern oder anderen Bezugspersonen anzuvertrauen, da es davon ausgeht, dass der erwachsenen, angesehenen Person mehr geglaubt wird als ihm selbst.
Die Manipulation des Opfers
Täter und Täterinnen intensivieren nun die Beziehung zu ihren Opfern. Sie steigern z.B. ihre emotionale Zuwendung, machen Mädchen und Jungen Geschenke, geben ihnen das Gefühl, wichtig und etwas ganz Besonderes zu sein. Kinder genießen in der Regel diese spezielle Zuwendung, Anerkennung und Beachtung. Und genau dies setzen Täter bzw. Täterinnen ein, um ihre Opfer immer mehr in eine scheinbar unauflösbare Beziehung zu verstricken. Täter und Täterinnen sind Meister darin, eine für das Kind/Jugendlichen wichtige Bindung herzustellen. Gleichzeitig steigern sie die sexuellen Übergriffe. Häufig wird die sexuelle Ausbeutung in der Anfangsphase als Pflegeverhalten oder Spiel getarnt. Täter und Täterinnen tun oft so, als ob sexuelle Übergriffe Ausdruck von Zuneigung und Zärtlichkeit, von Sorge um die körperliche Entwicklung des Kindes oder von Aufklärung wären. Häufig betten sie die sexuelle Ausbeutung in „Alltagshandlungen“ ein.
Den Widerstand des Opfers ignorieren
Kinder merken, wenn irgendetwas im Spiel „komisch“ oder eigenartig ist. Doch Täter bzw. Täterinnen nutzen ihre erwachsene Überlegenheit aus, um ihren Opfern zu versichern, dass alles in Ordnung und normal ist. Mädchen und Jungen spüren sehr deutlich den Unterschied zwischen zärtlicher Zuwendung und sexuellen Grenzverletzungen. Sie möchten die emotionale Zuwendung nicht verlieren und haben Schwierigkeiten, sich offensiv zur Wehr zu setzen. Z.B. kichern sie ein verlegendes „Nein“, machen ihren Körper steif, drehen den Kopf weg. Diese Signale werden von Tätern bzw. Täterinnen zwar erkannt, aber ignoriert und übergangen.
Redeverbot
Täter und Täterinnen erklären die sich steigernden sexuellen Missbrauchshandlungen zum gemeinsamen „kleinen Geheimnis“ und reden damit Mädchen und Jungen eine aktive Beteiligung ein. Z.B. müssen Kinder mit einem „großen Indianerehrenwort“ schwören, über die gemeinsamen „Spielereien“ zu schweigen. Kleine Kinder „verplappern“ zwar meist zunächst das Erlebnis, doch ihre Umwelt nimmt das scheinbar Unglaubliche nicht ernst oder wahr. Nach einer Weile beugen sich die Opfer meist dem Schweigegebot, sie schämen sich und spüren, dass es „besser“ ist, den Mund zu halten.
Opfer zum Schweigen bringen
Wenn der Widerstand von Mädchen und Jungen zunimmt, setzen Täter bzw. Täterinnen oftmals massivere Mittel ein, um das Opfer zum Schweigen zu bringen. Dabei verfügen sie über eine große Palette von „Argumenten“, in der das Einreden einer aktiven Beteiligung des Opfers, Liebesbeteuerungen, das Erregen von Mitleid, Drohungen, Erpressungen bis hin zu schlagender Gewalt enthalten sind. Zumeist wird dem Opfer erst sein „eigenes“ Verhalten vor Augen geführt: „Du hast ja mitgemacht“, „Dir hat es ja auch Spaß gemacht.“, „Hättest du nur deutlich NEIN gesagt, ich hätte sofort aufgehört.“ Eine andere Variante ist: „Wenn die anderen wüssten, was du hier mit mir gemacht hast…!“ Oder: „Ich tue das doch nur, weil ich dich so unendlich liebe.“
Oft droht ein Täter oder eine Täterin: „Wenn du darüber redest, wird deine Mama krank …, glaubt Dir sowieso keiner …, dann hat dich keiner mehr lieb …, dann kommen wir beide ins Gefängnis …, dann kommst du ins Heim. …, dann machst du die Familie kaputt, dann stirbt dein Haustier …,“
Auch hier sorgt die kognitive Überlegenheit dafür, dass das Kind solche Drohungen zunächst ernst nimmt. In Fällen, in denen der Täter bzw. die Täterin sich nicht sicher ist, ob das Schweigegebot hält, kann es durchaus vorkommen, dass das Haustier tatsächlich sterben muss oder aber der Täter bzw. die Täterin schlagende Gewalt einsetzt, um seinem/ihrem Wunsch Nachdruck zu verleihen.
Wenn der Missbrauch in religiösem Kontext geschieht, bringen Täter bzw. Täterinnen den „lieben Gott“ noch ins Spiel: Er hat z.B. ‚angeordnet‘, gerade dieses Kind „für Sünden zu bestrafen“ oder aber Er lässt das Opfer fallen, wenn es darüber spricht.
Mädchen und Jungen, deren sexueller Missbrauch mittels digitaler Medien dokumentiert wurde
Das Gefühl der Erniedrigung und Beschämung der Opfer steigt mit der filmischen oder fotografischen Dokumentation der sexuellen Ausbeutung. Im Unterschied zu den Opfern sexueller Gewalt ohne Dokumentation bedeutet das digitale Festhalten der sexuellen Ausbeutung für die Opfer, dass der Missbrauch niemals endet.
Betroffene leben bis ins Erwachsenenalter in der berechtigten Angst, dass das Film- und Bildmaterial noch im Umlauf ist und jemand sie erkennt.
Jeder Mensch, dem sie begegnen, könnte die Aufnahmen gesehen haben. Einmal ins Internet gestellt, sind die Daten nicht mehr rückrufbar. Es gibt keine Möglichkeit der Kontrolle, auf welchen Computer irgendwo in der Welt die Daten kopiert werden.