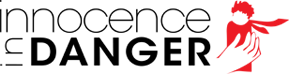Kinderpornographie § 207a
Strafbar macht sich, wer pornographische Darstellungen einer minderjährigen Person (unter 18) herstellt, anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht. Seit Juni 2009 macht sich auch strafbar, wer wissentlich auf eine pornografische Darstellung Minderjähriger zugreift. Damit wird auch das bloße Anschauen erfasst. Um Fälle auszuschließen, in denen jemand zufällig auf Kinderpornographie stößt, wird auf Wissentlichkeit abgestellt. Von Wissentlichkeit wird man ausgehen können, wenn jemand wiederholt auf eine Seite zugreift. Die Tatbestände sind sehr unterschiedlich geregelt und je nach Altersgruppe (Unmündige unter 14 und mündige Minderjährige von 14 bis 18), Beeinträchtigung der Opfer und Gewerbsmäßigkeit mit Freiheitsstrafen von 1 Jahr bis 10 Jahren bedroht.
Was man unter Pornographie versteht, ist in § 207a Abs. 4, abweichend von der Definition des Pornographiegesetzes, geregelt. Danach fällt auch die sogenannte Anscheinspornographie darunter, also eine Abbildung, die nur den Anschein erweckt, es handle sich um geschlechtliche Handlungen, sowie realistische Bilder (also keine Fotos von echten Menschen).
In Österreich ist der Besitz kinderpornografischer Darstellungen ebenso wie der wissentliche Zugriff auf kinderpornografische Darstellungen im Internet strafbar. Kinderpornografie können bildliche Darstellungen von geschlechtlichen Handlungen, in die Minderjährige involviert sind, oder die Abbildung der Genitalien oder der Schamgegend von Minderjährigen sein. Missbrauchsdarstellungen von Kindern unter 14 Jahren sind immer strafbar. Bereits der Eindruck, dass es zu einer sexuellen Handlung gekommen ist, reicht aus (z.B. Fotomontagen).
In der Regel werden die Inhalte einer Seite schon beim bloßen Ansehen im Internet automatisch auf der Festplatte gespeichert (meist in einem Ordner für temporäre Dateien) – bereits das kann als Besitz eines Bildes gelten. Wissentlicher Zugriff kann z.B. angenommen werden, wenn auf eine Seite mit eindeutigem Inhalt wiederholt zugegriffen wird.
Seit 1. Jänner 2012 ist das sogenannte „Grooming“ (Anbahnung sexueller Kontakte zu Unmündigen über das Internet) und die „Betrachtung pornografischer Darbietungen Minderjähriger“ (live mittels Web-Cam) gerichtlich strafbar.
Nähere Informationen zum Thema „Grooming“ sowie „Pornografie im Internet“ finden sich auf dem IKT-Sicherheitsportal.
Kinderpornografische Inhalte können online – auch anonym – bei der Meldestelle „Stopline“, schriftlich, per Fax oder E-Mail bei den Meldestellen der Kriminalpolizei gemeldet werden.
Link § 206 ÖStGB
§ 207b StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen
Gesetzestext
(1) Wer an einer Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und aus bestimmten Gründen noch nicht reif genug ist, die Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, unter Ausnützung dieser mangelnden Reife sowie seiner altersbedingten Überlegenheit eine geschlechtliche Handlung vornimmt, von einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder eine solche Person dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Wer an einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unter Ausnützung einer Zwangslage dieser Person eine geschlechtliche Handlung vornimmt, von einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder eine solche Person dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
(3) Wer eine Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unmittelbar durch ein Entgelt dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an ihm oder einem Dritten vorzunehmen oder von ihm oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
Link § 207 ÖStGB
§ 208a StGB „Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen“
(Cybergrooming)
Die Strafgesetznovelle trat am 1. Januar 2012 in Kraft trat und verbietet die „Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen“ (Personen unter 14 Jahren).
Der neu geschaffene § 208a StGB lautet:
(1) Wer einer unmündigen Person in der Absicht, an ihr eine strafbare Handlung nach den §§ 201 bis 207a Abs. 1 Z 1 zu begehen, 1. im Wege einer Telekommunikation, unter Verwendung eines Computersystems oder 2. auf sonstige Art unter Täuschung über seine Absicht ein persönliches Treffen vorschlägt oder ein solches mit ihr vereinbart und eine konkrete Vorbereitungshandlung zur Durchführung des persönlichen Treffens mit dieser Person setzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.
(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig und bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, sein Vorhaben aufgibt und der Behörde sein Verschulden offenbart.“
Im § 215a wird nach dem Abs. 2 folgender Abs. 2a eingefügt:
„(2a) Wer wissentlich eine pornographische Darbietung, an der eine mündige minderjährige Person mitwirkt, betrachtet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer wissentlich eine pornographische Darbietung, an der eine unmündige Person mitwirkt, betrachtet.“
Link § 208 ÖStGB
Ausführlichen Gesetzestext downloaden.